2040 – Am Rande der Stadt
Die Zukunft ist woanders
Es ist noch dunkel, als er am Tisch sitzt.
Die Strickjacke hat er übergezogen, ohne darüber nachzudenken. Sie liegt griffbereit auf der Stuhllehne. Das macht er schon eine Weile so. Die Heizung läuft, aber nicht hoch. Das reicht.
Draußen sieht man nichts. Früher stand an der Ecke eine Straßenlaterne. Sie wurde irgendwann nicht mehr repariert. Jetzt ist es einfach dunkel. Man gewöhnt sich daran. Die Augen stellen sich um.
Er legt die Hände um die Tasse, ohne sofort zu trinken. Der Ingwer zieht noch. Er hat gelernt, dass man warten muss. Zu heiß schmeckt er nicht, zu kalt auch nicht. Das hat nichts mit Geduld zu tun. Eher mit Aufmerksamkeit.
Der Morgen kommt langsam. Nicht als Moment, eher als Übergang. Erst wird es ein wenig heller im Fenster, dann ein wenig weniger schwarz. Kein Geräusch von draußen. Kein Motor. Kein Schritt.
Er sitzt da und lässt es zu. Zeit hat er genug. Das ist kein Problem mehr.
Früher war der Morgen etwas, das begann. Jetzt ist er etwas, das man begrüßt.
Er nimmt einen Schluck, stellt die Tasse wieder ab. Wartet.
Der Tag wird schon kommen.
Er bleibt am Fenster stehen. Nicht aus Unentschlossenheit, eher aus Gewohnheit. Draußen liegt das Dorf still, so still, dass man meint, es halte den Atem an. Kein Motor, kein Schritt, kein Licht, das zufällig angeht. Nur Flächen und Umrisse, die langsam sichtbar werden, während der Morgen sich herantastet.
So sieht ein ruhiger Morgen aus. Das hat er sich früher manchmal gedacht. Nicht als Plan, eher als Vorstellung. Jetzt steht er darin.
Die Ruhe ist gleichmäßig. Sie verändert sich nicht. Nichts kommt dazu, nichts geht weg. Er merkt, wie schnell man sich daran orientiert. Das Auge sucht nicht mehr nach Bewegung, das Ohr nicht mehr nach Geräuschen. Man stellt sich darauf ein.
„Eigentlich ist das ja schön“, sagt er leise.
Der Satz bleibt stehen. Er passt. Er braucht keine Ergänzung.
Er steht noch einen Moment. Wartet nicht. Schaut nur. Das Dorf liegt da, wie es liegt. Es wird nicht gleich anfangen, es wird nicht unterbrechen. Es ist einfach da.
Er weiß, wie das geht. Sich daran gewöhnen. Das hat er oft genug getan. Man nennt es irgendwann nicht mehr Umstellung, sondern Alltag.
Er tritt vom Fenster zurück.
Der Morgen ist da. Das reicht.
Der Rucksack steht auf dem Tisch. Oben liegt das Brot, sauber eingeschlagen. Darunter die Gläser, durch ein Tuch getrennt. Er hat sie so gelegt, dass nichts aneinanderstößt. Das macht er immer so. Alles hat seinen Platz. Wenn man darauf achtet, hält es.
Er zieht den Mantel vom Haken. Er ist ein wenig zu groß geworden über die Jahre. Nicht vom Stoff her, sondern vom Körper. Die Schultern sitzen tiefer, der Stoff fällt anders. Er zieht ihn über die Strickjacke, langsam, zieht den Reißverschluss bis nach oben. Das reicht.
Die Mütze liegt auf der Kommode. Er setzt sie auf, zieht sie über die Ohren. Dann die Handschuhe. Einer sitzt etwas enger als der andere. Das war schon immer so.
Er nimmt den Rucksack, öffnet noch einmal kurz den Reißverschluss, sieht hinein, schließt ihn wieder. Kein Grund. Nur ein Blick.
Dann öffnet er die Tür und tritt hinaus.
Draußen ist es kalt. Nicht unangenehm, eher gleichmäßig. Die Luft steht still. Es ist heller als vorhin, aber noch ohne Farbe. Das Dorf liegt da, wie es immer liegt. Nicht schlafend. Wartend auch nicht. Einfach da.
Er geht los.
Die Straße ist leer. Keine Spur von Bewegung. Die Häuser stehen dicht an dicht, jedes für sich. An einem Dach flattert eine Plane leicht im Wind. Sie ist festgebunden, schon lange. Der Schaden darunter ist alt. Man sieht es am Rand, wo das Material nachgegeben hat. Es hält noch.
Ein paar Schritte weiter steht ein Haus, in dem niemand mehr wohnt. Der Briefkasten hängt schief, aber er wird nicht abmontiert. Man könnte ihn richten. Es macht nur niemand mehr.
Er geht an der Bushaltestelle vorbei. Der Fahrplan hängt noch. Er bleibt kurz stehen, schaut nicht genau hin. Er weiß, was da steht. Und was nicht mehr stimmt. Das gehört inzwischen dazu.
Der Weg führt weiter durch das Dorf. Ein Garten, der noch gepflegt ist. Einer, der es nicht mehr ganz schafft. Beete, die sauber abgedeckt sind. Andere, die offen liegen. Man erkennt, wer noch etwas versucht und wer nicht mehr kann. Es steht nirgendwo geschrieben.
Er hört Schritte hinter sich, bleibt nicht stehen. Sie kommen näher, gehen vorbei. Ein Mann mit einer Tasche. Sie nicken sich zu. Mehr braucht es nicht.
Weiter vorne steht das Verwaltungsgebäude. Das Schild hängt schief. Die Öffnungszeiten sind mit Stift ergänzt. Er liest sie nicht. Er war da. Er weiß, wie es ist.
Der Weg wird flacher. Am Ende steht die Bank mit dem Tisch. Noch leer. Das Holz ist dunkel, glatt an den Stellen, wo man sitzt. Er stellt den Rucksack ab, setzt sich nicht sofort. Schaut kurz über den Platz. Alles ist still. Es wird gleich jemand kommen. Oder auch nicht.
Er wartet nicht.
Er ist einfach da.
Er setzt sich auf die Bank. Langsam, mit beiden Händen kurz am Tisch, bevor er das Gewicht verlagert. Das Holz ist kalt, aber nicht unangenehm. Es gibt Halt. Er rückt den Rucksack neben sich, lässt ihn geschlossen.
Für einen Moment ist nichts.
So ähnlich hatte es sich früher angefühlt, wenn er sich an den Schreibtisch gesetzt hatte. Nicht morgens, wenn alles lief, sondern zwischendurch. Wenn gerade nichts anstand. Wenn der Bildschirm leer war und die Gedanken kurz woanders hin durften. Damals hatte er manchmal aus dem Fenster geschaut und gedacht, dass es gut wäre, jetzt nicht hier zu sein. Irgendwo am Meer vielleicht. Mittelmeer. Wärme. Licht. Bewegung ohne Zweck.
Er hatte sich das vorgestellt, während er saß. Und dann weitergemacht.
Jetzt sitzt er wieder. Nicht am Schreibtisch, sondern hier. Draußen. Kein Bildschirm, kein Fenster. Nur der Platz vor ihm, der Tisch, die leere Bank gegenüber. Er merkt, dass er nichts anderes tun müsste. Nichts wartet. Nichts liegt liegen.
Der Gedanke kommt leise: Eigentlich müsstest du doch was anderes tun.
Er lässt ihn stehen. Er kennt ihn. Früher hatte der Gedanke Druck gemacht. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist er eher eine Erinnerung daran, dass es ihn einmal gegeben hat.
Er atmet aus, zieht die Schultern ein wenig hoch, dann wieder runter. Das Sitzen fühlt sich richtig an. Nicht besonders. Einfach passend.
Er hat, was er braucht. Zeit. Etwas zu essen. Etwas Warmes zu trinken. Menschen, die gleich kommen oder auch nicht. Es reicht.
Er sitzt da und ist zufrieden. Nicht glücklich, nicht erleichtert. Zufrieden im Sinne von: nichts fehlt gerade.
Das war früher anders gewesen. Da hatte immer etwas gefehlt. Obwohl alles da war.
Er legt die Hände auf den Tisch, wartet nicht auf etwas Bestimmtes.
Der Vormittag ist noch lang.
Die Sonne ist da, theoretisch. Man merkt es am Licht, das heller wird, ohne warm zu sein. Sie kommt nicht durch. Der Himmel bleibt grau, gleichmäßig, ohne Richtung. Januar eben.
Er sitzt am Tisch und wartet. Nicht auf etwas Bestimmtes. Eher darauf, dass die Zeit weitergeht. Das tut sie immer, auch ohne Anlass.
Irgendwo ist ein Geräusch. Nicht laut. Ein paar Takte Musik, kaum mehr als ein Echo. Vielleicht aus einem Auto, das langsam durch den Ort fährt. Vielleicht von weiter weg. Es ist sofort wieder weg, aber es reicht.
Irgendetwas von Weggehen.
Er muss nicht überlegen, woran es ihn erinnert. Das kommt von selbst. An diesen Gedanken, den man früher manchmal hatte. Nicht konkret, eher wie eine Möglichkeit. Einfach los. Zigaretten holen, irgendwo stehen bleiben, nicht zurückgehen. Nicht aus Trotz. Aus Neugier.
Er sitzt da und denkt kurz daran, wie das jetzt wäre. Im Januar. Nicht New York. Das war nie sein Ziel gewesen. Eher Mallorca. Sonne im Winter. Ein Hotel, das warm ist. Frühstück, das jemand anders macht. Ein anderer Tagesrhythmus. Nur für ein paar Tage.
Der Gedanke bleibt nicht lange.
Das macht man nicht mehr.
Nicht, weil es verboten wäre. Nicht, weil es unmöglich ist. Es passt einfach nicht mehr. Für jemanden wie ihn. In diesem Alter. Mit dem, was übrig geblieben ist. Es gibt Dinge, die lässt man anderen. Das ist keine Enttäuschung. Es ist eine Einordnung.
Er sitzt da und merkt, dass ihn das nicht unruhig macht. Früher hätte es das getan. Heute nicht mehr. Der Gedanke ist da, dann nicht mehr. Wie vieles.
Die Stille kommt zurück. Sie ist nicht neu. Sie war schon da, bevor die Musik kurz aufgetaucht ist. Jetzt ist sie wieder vollständig.
Er wartet weiter. Nicht auf etwas anderes.
Einfach so.
Der Vormittag vergeht.
Wie alle Vormittage jetzt.
Sie sitzt ihm gegenüber, die Hände um den Becher gelegt. Der Tee ist schon fast leer. Der Dampf steigt nicht mehr auf. Sie trinkt trotzdem langsam, als müsse sie sich Zeit lassen.
„Ich bin Physikerin“, sagt sie irgendwann. Nicht als Erklärung. Eher so, als würde sie etwas ablegen, das man eine Weile mit sich herumgetragen hat.
Er schaut kurz auf. Nickt. Er wusste das. Irgendwann hatte sie es erwähnt. Damals, als das Wort noch etwas bedeutete. Jetzt klingt es wie ein früherer Zustand.
„Viele sind gegangen“, sagt sie. „Schon während dem Studium. Spätestens danach.“
Sie zählt keine Länder auf. Er stellt sie sich trotzdem vor. Labore. Glas. Licht. Orte, an denen Dinge entstehen, die noch keinen Namen haben. Sie hätte dorthin gekonnt. Das weiß er. Sie auch.
„Ich hätte auch gehen können“, sagt sie. „Es gab Angebote.“
Sie sagt es ohne Bedauern. Ohne Stolz. Einfach als Tatsache.
„Aber meine Mutter…“, sagt sie und lässt den Satz offen. Er bleibt stehen, wo er stehen muss.
„Ich hab mir eingeredet, es sei nur für eine Weile“, sagt sie. „Ein paar Jahre. Dann schauen wir weiter.“
Sie lächelt kurz. Nicht bitter. Eher wissend.
„Jetzt schaue ich nicht mehr so viel“, sagt sie. „Es ist hier.“
Er nickt. Er kennt das. Dieses Verschieben, das irgendwann zum Bleiben wird.
„Die anderen machen jetzt spannende Sachen“, sagt sie. „Neue Materialien. Energie. Irgendwas mit Simulationen.“
Sie winkt ab, als ginge es um das Wetter.
„Manchmal schreiben sie“, sagt sie. „Fragen, wie es mir geht.“
„Und?“, fragt er.
„Es geht“, sagt sie. „Ich bin hier.“
Sie sagt es so, als wäre das die Antwort auf alles.
Eine Weile sitzen sie still. Der Platz ist ruhig. Kein Wind. Kein Geräusch von der Straße.
„Wissen geht nicht verloren“, sagt sie dann. „Es liegt nur woanders.“
Er denkt an den Garten. An die Gläser im Rucksack. An Dinge, die man kann, aber nicht mehr braucht. Oder braucht, aber nicht mehr dafür bezahlt wird.
„Hier braucht es anderes“, sagt er.
„Ja“, sagt sie. „Hier braucht es Bleiben.“
Sie stehen beide nicht auf. Noch nicht.
Die Zukunft ist nicht gegangen.
Sie ist nur woanders hingezogen.

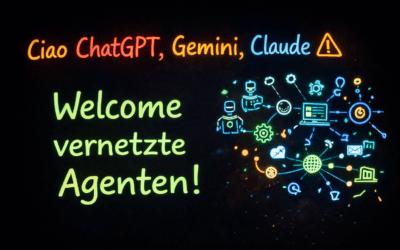


0 Kommentare